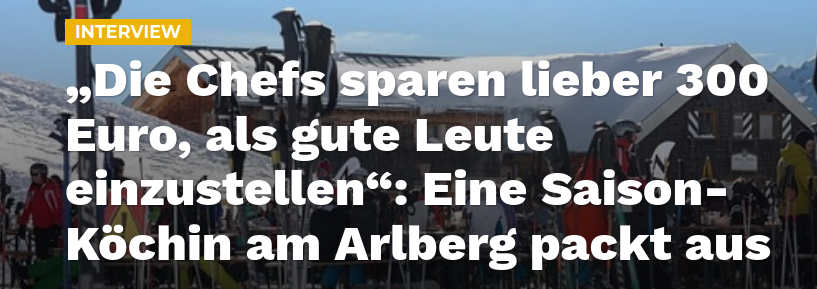21. Februar 2020
Interview
„Die Chefs sparen lieber 300 Euro, als gute Leute einzustellen“: Eine Saison-Köchin am Arlberg packt aus
Im Tourismus fehlt das Personal. Und das, obwohl die
Geschäfte boomen und genug Fachpersonal im Land wäre. Warum finden sich
dann keine Fachkräfte für die freien Stellen? Eine Köchin aus Arlberg in
Tirol erzählt über schlechte Bezahlung, anstrengende Dienste und
54-Stunden-Wochen.
„Das Gute am Job ist: Du bist sicher nie arbeitslos“, sagt uns Karola Pühringer (Name von der Redaktion geändert). Die 22-Jährige ist Saison-Patissier am Arlberg. Sie findet:
„Man muss den Job echt mögen. Ich mach meinen auch Job gerne. Aber es ist einfach zu viel Druck.“
Karola Pühringer verbringt ihren dritten Winter in Lech. Eigentlich wollte sie nach der Sommer-Saison, die für Gastro-Personal Mitte September endet, eine feste Stelle. „Mein Telefon hat dauernd geklingelt. Die Chefs suchen echt verzweifelt nach Leuten.“ Also ist sie nach zwei Monaten Pause zurück an den Arlberg, auf in die nächste 54-Stunden-Woche. Gehalt für die gelernte Köchin, die mittlerweile auf Patissier umgeschult hat: 1.750 Euro netto. Sechs Tage die Woche, 12-Stunden-Dienste zwischen 8.00 und 23.00.
Gehalt? „Auf die Überstunden bist du angewiesen“
„Der Dienst beginnt offiziell um halb neun, aber es wird gern gesehen, wenn man schon eine halbe Stunde früher da ist. Das heißt dann ‚Engagement zeigen‘. Das wird echt erwartet und wenn man es nicht tut, macht man sich unbeliebt. Bezahlt ist diese halbe Stunde ‚Engagement‘ aber nicht.“
Überstunden sind aber besonders wichtig für Gastro-Personal: Man rechnet fix mit Überstunden und Trinkgeld, sonst „geht sich das einfach nicht aus bei dem Gehalt“. In der Realität der Ski-Dörfer laufen die Dinge aber oft anders.
Seit der schwarz-blauen Gesetzesänderung gibt es reguläre 12-Stunden-Dienste. Das hätte dafür sorgen sollen, dass weniger Stunden unbezahlt bleiben. Real passiert das Gegenteil: Karola hat in den ersten beiden Monaten der Wintersaison über 130 Überstunden gemacht – zusätzlich zu ihrer 54-Stunden-Woche, zu der vertraglich verpflichtete 2 Überstunden die Woche kamen. Pühringer musste mehr Überstunden machen als gesetzlich erlaubt sind, weil zu wenig Personal da war. Nach zwei Monaten wurde sie mit 2.000 Euro „Überstunden-Pauschale“ abgespeist.
Das war Grund genug für sie, ihren Posten während der Saison zu verlassen. Sie fiel zusätzlich um ihren Anteil am Trinkgeld um – denn das wird oft erst am Ende der Saison ausgezahlt.
„Beziehungen? Funktionieren nicht!“
„Es gibt real fast nirgends Dienstpläne. Im letzten Hotel waren wir selbst für unser Kommen und Gehen verantwortlich. Aber halt auch für den ganzen Posten. Das waren bei mir 100 Tische in einem Dienst. Bei gutem Wetter schickt die Küche schon mal tausend Teller in drei Stunden.“ Das heißt real: Immer geteilte Dienste mit wenigen „Zimmerstunden“ dazwischen, sechs oder sieben Tage die Woche. Der Dienst fängt um 8.30 an, geht bis 14 Uhr und dann wieder von 17:00 bis 22:30.
Die Arbeitszeiten sind hart und mit Familie oder Privatleben kaum vereinbar. „Ich war früher in einer Tanz-Gruppe, das ging schon in der Lehrzeit nicht mehr.“ Wer sich in einem Verein engagieren möchte, ist in der Gastro schlecht aufgehoben. Ein Leben außerhalb des geteilten Dienst-Betriebs ist schwierig zu führen.
In Saison-Orten ist die Situation besonders prekär. An einem freien Tag in der Woche kommt man kaum raus aus den abgelegenen Dörfern. Ist man im Winter eingeschneit, ist man völlig isoliert. Wer sich mit den Kollegen nicht gut versteht, vereinsamt.
Wer durchhält, dem winkt zwar ein weitaus besseres Gehalt – Küchenchefs verdienen zwischen 4.00 und 5.000 Euro netto. Aber der Preis dafür ist hoch: Alkoholmissbrauch, Burnout, Herzkrankheiten sind weit verbreitete Berufskrankheiten.
„Die Gefahr ist schon: Entweder du verhärtest und vereinsamst total, oder du stirbst mit 50 an einem Herzinfarkt“ – wie auch Pühringers Lehrherr.
„Du kommst einfach nicht runter“
„In der Freizeit zwischen den Diensten ist es echt schwer, runter zu kommen.“ Nach dem Mittagsgeschäft gibt es drei Stunden Pause im Dienstplan. Theoretisch könnte Karola Pühringer in der Zeit den Arlberg genießen, spazieren oder eine kleine Runde Ski fahren gehen, wie es in Stellenausschreibungen oft heißt. Die Realität schaut anders aus: „Von zwei bis drei Uhr schreibe ich fast jeden Tag Bewerbungen, dann leg ich mich eine Stunde hin. Und dann geht’s eh schon wieder weiter.“
Der Abenddienst geht bis elf Uhr. Als Patissier verlässt Karola als Letztes die Küche, länger noch arbeiten die Abwäscher und Kellnerinnen. Dann ist an Schlaf aber nicht zu denken. Das Adrenalin des stressigen à la Carte-Geschäfts arbeitet noch im Körper.
„Ich trinke schon mal eine Flasche Wein, bis ich um ein Uhr schlafen kann. Zwischen elf und eins heißt’s Duschen, das Zimmer aufräumen, Sachen für den nächsten Tag herrichten.“ Nach sechs Stunden Schlaf geht es weiter.
In der Früh gibt es in vielen Küchen kein „Guten Morgen“, sondern einen Anpfiff, weil am Vortag Dinge schiefgelaufen sind. Wer widerspricht, macht sich unbeliebt. Die Hierarchie in den Küchen ist steil und streng. Vor allem als Frau braucht man eine dicke Haut, weiß Pühringer.
Natürlich gibt es auch „gute Chefleute“, weiß auch Pühringer. Aber ohne festes Team lässt sich nicht strukturiert arbeiten. Die Küchen sind im Teufelskreis aus schlechten Arbeitsbedingungen, Lohndumping und fehlenden Fachkräften.
Die Lösung? Bessere Löhne, bessere Arbeitszeiten
Unter Schwarz-Blau haben die Hoteliers neben dem 12 Stunden-Tag, der seither rege genutzt wird, auch ein ordentliches Steuergeschenk gekriegt: Ihr Steuersatz wurde von 13 auf zehn Prozent gesenkt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen, die regulär 20 Prozent Mehrwertsteuer zahlten, gibt der Tourismus also nur die Hälfte ab.
Den Fachkräftemangel haben diese Maßnahmen nicht gelöst, denn der Gewinn kommt nicht beim Personal an.
WKO-Chef Harald Mahrer hat am Ende der Wintersaison zum Krisengipfel gerufen. Eingeladen waren 60 der Hoteliers, die seit Jahren nach Lösungen aus der Politik rufen. Mit ihnen und den Ministerinnen Köstinger (Tourismus), Aschbacher (Arbeitsmarkt) und Schramböck (Wirtschaft) – alle ÖVP – findet er folgende Antworten:
Mehr Kinderbetreuungsplätze in Tourismus-Gegenden, und vor allem: Flexbilisierung der Arbeitskräfte. Mit anderen Worten: Arbeitssuchende sollen noch stärker dazu gezwungen werden, für ihren Job umzuziehen. Gerade dem Saison-Tourismus kommt das entgegen, denn hier gibt es kaum Ganzjahresstellen. Wer im Winter am Arlberg ist, muss im Sommer an den Wörthersee.
Wer das kann, tut das allerdings jetzt schon: Karola Pühringer ist für ihren Beruf in fünf Jahren bereits vier Mal umgezogen. „Ich hab keine Kinder, bei mir geht das gut.“ Dass ein Umzug alle paar Monate mit Kind kaum machbar ist, ist klar. Daran ändern auch Kinderbetreuungsplätze vor Ort wenig.
Eine verschränkte und verlängerte Lehre für Hotel- und Restaurantfachleute mit vier statt drei Jahren „bringt keine bessere Ausbildung, sondern billige Arbeitskräfte“, ist sich eine ehemalige Hotelfachfrau sicher. Gleiches gelte für die Jobbörse für Asylberechtigte, die Wirtschaftsministerin Aschbacher ankündigt.
„Die Chefleute sparen lieber 300 Euro, als gute Leute einzustellen“
Karola Pühringer kennt das Problem ihrer Chefleute, wie sie sie nennt. Man findet kaum mehr Leute, die am Arlberg arbeiten wollen. Zumindest nicht zu den gebotenen Konditionen. „Man spart lieber 300 oder 500 Euro, anstatt gutes Personal zu holen.“ Sie arbeitet gerne mit Leuten von überall aus der Welt, das ist Teil der Arbeitsrealität in einer Küche.
Das Problem: Die billigen Arbeitskräfte, die aus Osteuropa engagiert werden, sind keine Fachkräfte und werden kaum eingeschult. Da kann es dann schon mal passieren, dass ein Portugiese Kässpätzle mit Oregano und Thymian würzt, wie es Pühringer schon erlebt hat. Oder dass ein kroatischer Kellner einen Gast aus den USA nicht versteht und ihr ein Pilzgericht serviert – das Problem dabei: die Kundin war schwer allergisch und kippte kurz nach dem ersten Bissen vom Stuhl.
Die Schuld liegt dabei nicht an den Kollegen, findet Pühringer: Vor zehn Jahren gab es auch schon viele Kollegen aus dem Süden und Osten Europas am Arlberg. Damals habe der Betrieb aber besser funktioniert, weil Teams eingeschult wurden – und weil die Chefleute bereit waren, ordentlichen Lohn zu zahlen.
Das Lohndumping hat eine rasante Abwärtsspirale ausgelöst: Kroatische, ungarische oder slowakische junge Menschen kommen in die Skigebiete – oft ohne Saison-Stelle – und suchen vor Ort nach Arbeit. In ihren Herkunftsländern betragen die Durchschnittsgehälter zwischen 800 und 1.000 Euro brutto. Karola Pühringer erzählt, dass sie nicht über Agenturen nach Österreich kommen, sondern von privaten „Vermittlern“. Diese kassieren nach Pühringers Angaben 300 Euro pro vermittelter Person – egal, wie lange diese dann angestellt bleiben.
Oft handelt es sich dabei um Bürokauffrauen, Physiotherapeuten oder Kosmetikerinnen, die nicht als Fach-, sondern als Hilfskräfte angestellt werden können. Das drückt den Preis weiter, und hebt gleichzeitig den Druck auf die Fachkräfte, die mitten in der Saison Hilfskräfte einschulen müssen.
Die sinkenden Löhne und der hohe Druck sorgen nämlich dafür, dass ständig Kollegen wieder gehen. Pühringer selbst hat in zwei Monaten schon 15 Kolleginnen und Kollegen am Arlberg verabschiedet. Ihre Plätze werden oft nur provisorisch aufgefüllt.
„Wer da ist, arbeitet, bis er es nicht mehr aushält“
Karola Pühringer arbeitet sechs Tage die Woche, seit sie 17 ist. Von den 22 Köchinnen und Köchen, mit denen sie die Berufsschule besucht hat, ist nicht mal mehr die Hälfte im Beruf. „Die Qualität der Lehre ist so abhängig von dem, der dich ausbildet.“ Diese Abhängigkeit ändert sich auch später nicht.
„Man weiß ja, worauf man sich einlässt, wenn man den Beruf ergreift. An fünf Tagen in der Woche wär das auch echt kein Problem. Aber niemand tut sich den Aufwand an, den Dienstplan zu organisieren, weil so viel Wechsel im Personal ist.“
„Es ist nicht schwierig, einen Job zu finden. Es ist schwierig, einen Job zu finden, der halbwegs passt“
Auch Pühringer denkt nach nur fünf Jahren im Beruf über einen Wechsel nach. Zuerst hat sie von Köchin auf Patissier umgeschult, aber die Jobvermittlungs-Agentur vermittelt ihr diese Stellen nicht. Zu viele offene Stellen für Köchinnen sind offen. Also bewirbt sie sich auf eigene Faust weiter. Denn dass es auch anders geht, weiß sie.
„Ich suche jetzt nur noch Stellen mit 5-Tage-Woche.“ Wer Montag bis spät abends arbeitet, hat nicht viel vom freien Dienstag, außer ein bisschen mehr Schlaf. Der freie Tag ist meistens kurz: „Lange aufbleiben geht nicht, wenn ich am nächsten Tag Frühdienst hab.“
Sie hat auch gute Erfahrungen gemacht, würde gerne im Beruf bleiben – nur eben nicht unter den derzeitigen Bedingungen. Dafür ist sie mittlerweile auch bereit, auf Gehalt zu verzichten. „Eine 5-Tage-Stelle bringt nicht mehr als 1.400 Euro netto. Aber das wär’s mit wert, wenn’s nicht anders geht.“
„Ich mach den Job wirklich gerne, aber 54 Stunden Regelarbeitszeit zwischen halb acht un der Früh und halb elf in der Nacht für 1.700 Euro netto, das geht einfach nicht.“
Quelle https://kontrast.at/tourismus-gehalt-gastronomie/